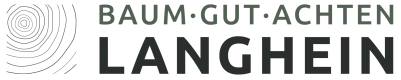Die Verkehrssicherheit von Bäumen ist ein zentrales Anliegen für Grundstückseigentümer, Kommunen und alle Verantwortlichen im öffentlichen Raum. Um potenzielle Gefahren durch Bäume zu minimieren und rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, sind regelmäßige Baumkontrollen und gegebenenfalls Baumgutachten unerlässlich. Dieser Beitrag beleuchtet die aktuellen Regularien in Deutschland, insbesondere die FLL-Baumkontrollrichtlinien, und gibt einen umfassenden Überblick über die rechtlichen Grundlagen, die Durchführung von Baumkontrollen sowie die Erstellung von Baumgutachten.
Rechtliche Grundlagen der Verkehrssicherungspflicht
In Deutschland sind Baumeigentümer verpflichtet, die Verkehrssicherheit ihrer Bäume zu gewährleisten. Diese Pflicht leitet sich aus § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ab, der die Haftung für Schäden regelt, die durch Verletzung der Verkehrssicherungspflicht entstehen. Demnach muss der Eigentümer dafür sorgen, dass von seinen Bäumen keine Gefahr für Dritte ausgeht. Bei Vernachlässigung dieser Pflicht kann er für entstandene Personen- oder Sachschäden haftbar gemacht werden.
Die Rechtsprechung hat im Laufe der Jahre die Anforderungen an die Baumkontrolle konkretisiert. So wurde beispielsweise entschieden, dass eine regelmäßige Kontrolle in angemessenen Abständen erforderlich ist, wobei die Häufigkeit von Faktoren wie Standort, Baumart und Alter des Baumes abhängt. Zudem sind besondere Ereignisse wie Stürme oder andere extreme Witterungsbedingungen Anlass für zusätzliche Kontrollen.
Die FLL-Baumkontrollrichtlinien
Die Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) hat mit den Baumkontrollrichtlinien ein Standardwerk geschaffen, das als Leitfaden für die Praxis dient. Die aktuelle Ausgabe der Richtlinien wurde im Mai 2020 veröffentlicht und berücksichtigt neueste Erkenntnisse sowie rechtliche Entwicklungen.
Ziel und Anwendungsbereich
Die FLL-Baumkontrollrichtlinien zielen darauf ab, einheitliche Standards für die Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen festzulegen. Sie richten sich an alle Personen und Institutionen, die für die Kontrolle von Bäumen verantwortlich sind, einschließlich Kommunen, Unternehmen und private Eigentümer. Der Anwendungsbereich umfasst dabei sowohl Bäume im urbanen Raum als auch solche an Waldrändern und entlang von Verkehrswegen.
Definitionen und Begriffe
Die Richtlinien unterscheiden klar zwischen verschiedenen Arten von Kontrollen:
- Baumkontrolle: Oberbegriff für alle Maßnahmen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen.
- Regelkontrolle: Turnusmäßige, visuelle Inaugenscheinnahme des Baumes vom Boden aus, um dessen Zustand zu beurteilen.
- Zusatzkontrolle: Außerplanmäßige Kontrolle, die beispielsweise nach extremen Witterungsereignissen, Schadensfällen oder erheblichen Veränderungen im Baumumfeld erforderlich wird.
Diese klare Terminologie erleichtert die Kommunikation und stellt sicher, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis der erforderlichen Maßnahmen haben.
Durchführung der Regelkontrolle
Die Regelkontrolle bildet das Fundament der Baumüberwachung. Sie erfolgt in der Regel einmal jährlich, kann jedoch je nach Standortbedingungen, Baumart und spezifischen Gefährdungspotenzialen angepasst werden. Bei der Kontrolle werden folgende Aspekte berücksichtigt:
- Vitalität des Baumes: Beurteilung des allgemeinen Gesundheitszustands, erkennbar an Blattwerk, Trieben und allgemeinem Erscheinungsbild.
- Standsicherheit: Überprüfung auf Anzeichen von Wurzel- oder Stammschäden, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Bruchsicherheit: Identifikation von Rissen, Faulstellen oder anderen Defekten, die das Risiko von Ast- oder Stammbrüchen erhöhen.
- Umfeldbedingungen: Bewertung von Veränderungen im unmittelbaren Umfeld des Baumes, wie Bodenverdichtungen, Bauarbeiten oder anderen Eingriffen, die den Baum beeinflussen könnten.
Die Ergebnisse der Regelkontrolle werden detailliert dokumentiert, um bei Bedarf als Nachweis der durchgeführten Maßnahmen zu dienen.
Eingehende Untersuchungen
Wenn bei der Regelkontrolle Auffälligkeiten festgestellt werden, die eine genaue Beurteilung erschweren, sind eingehende Untersuchungen erforderlich. Diese gehen über die visuelle Kontrolle hinaus und können den Einsatz spezieller Geräte und Methoden beinhalten, wie:
- Bohrwiderstandsmessungen: Zur Feststellung von Holzzersetzungen im Inneren des Stammes.
- Schalltomographie: Ermöglicht die Darstellung von Fäulen oder Hohlräumen im Stamm.
- Zugversuche: Testen die Stand- und Bruchsicherheit des Baumes unter simulierten Windlasten.
Solche Untersuchungen liefern präzise Daten über den Zustand des Baumes und bilden die Grundlage für fundierte Entscheidungen über notwendige Pflegemaßnahmen oder Fällungen.
Artenschutz und Baumkontrolle
Ein wichtiger Aspekt, der in den aktuellen Baumkontrollrichtlinien berücksichtigt wird, ist der Artenschutz. Mit der Einführung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) im Jahr 2010 haben sich die Anforderungen an die Baumkontrolle verändert. Es gilt, einen Ausgleich zwischen der Verkehrssicherungspflicht und dem Schutz von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen zu finden. Die Richtlinien betonen, dass weder die Verkehrssicherungspflicht noch der Artenschutz absolut vorrangig sind, sondern stets im Einzelfall abgewogen werden müssen.
Musterdienstanweisung für Baumkontrollen
Zur Unterstützung der Praxis haben die Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK) und der Arbeitskreis Stadtbäume der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz eine Musterdienstanweisung erarbeitet. Diese enthält verbindliche Vorgaben zur Durchführung und Dokumentation von Baumkontrollen für Kommunen und andere Verantwortliche.
Fazit
Die aktuellen Regularien zur Baumkontrolle und Baumgutachten stellen sicher, dass die Verkehrssicherheit gewahrt bleibt, ohne den Artenschutz zu vernachlässigen. Durch die regelmäßige Anwendung der FLL-Baumkontrollrichtlinien und die Dokumentation der Kontrollen können Haftungsrisiken minimiert und nachhaltige Baumbestände erhalten werden.